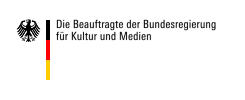Wo war einst in Deutschland die Klein- bis Kleinststaaterei – oder positiver formuliert: der Föderalismus – am stärksten ausgeprägt? In Schwaben, in Franken oder in Thüringen? Für all diese Annahmen sprechen Gründe. Für Thüringen spricht, wenn man von Nähe zur Gegenwart ausgeht. Als das Bundesland 2020 sein 100-Jähriges feierte, präsentierte es auf der Internetseite thueringen100.de (und präsentiert weiter) einen „wahren Flickenteppich“ aus „sieben Kleinstaaten“, die „nicht etwa scharf voneinander abgegrenzt, sondern förmlich miteinander verwoben“ waren und sich 1920, nach dem Ende des Feudalismus, zusammengeschlossen hatten. Eine Pointe bestand darin, dass einige Teile des heutigen Bundeslandes – von dem viele Nicht-Thüringer ja auch glauben,
... Weiterlesen